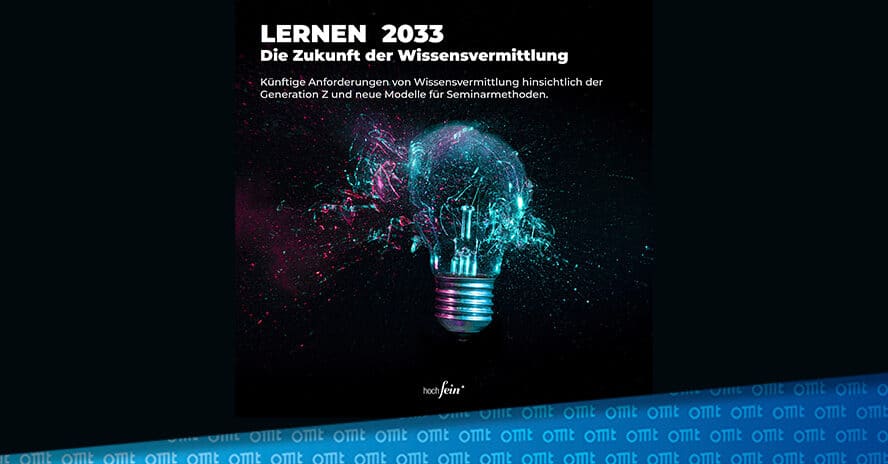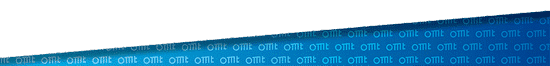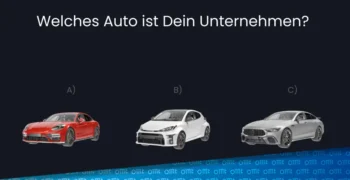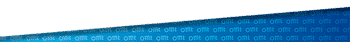Seminarteilnehmer:innen der Zukunft konsumieren keine eindimensionalen Informationen, sie lernen durch Erlebnisse.
Die Ansprache der Teilnehmer:innen sollte individuell und wertschätzend geschehen. Informationen werden in narrativer Form gelernt und nutzen erlebnisbasierte Formen des Lernens.
Dies bietet entscheidende Vorteile – für die erfolgreiche Vermittlung von Inhalten. Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Bedürfnisse aller Teilnehmenden. Das gilt besonders für die Wahl der Angebote.
Die Veränderung geht aber noch tiefer: Selbst die Ansprüche an Angebote ändern sich. Digitale Kompetenzen gewinnen zunehmend an Relevanz
Lern- und Nutzergewohnheiten werden individueller und müssen bei der Formulierung des Angebotes bedacht werden.
Ein kurzer Rückblick
Die Zeiten, an denen man sich mit Papier und Bleistift oder sogar Overhead Folien Gehör verschaffte, sind schon seit einer gefühlten Ewigkeit vorüber. Ebenso sind monologartige Vortragstrukturen ein Relikt aus einer Zeit, welche sich inzwischen selbst eingeholt hat.
Aktuelle Methoden wie Brainstorms oder Whiteboards, wie sie heute noch in der Praxis stattfinden, werden in Zukunft ebenso an Relevanz verlieren.
Die Pandemie und ihr Einfluss auf Lernmethoden
Die Pandemie war ein Katalysator in vielerlei Hinsicht. Prozesse, die sich bereits vor langer Hand angekündigt hatten, wurden nun beschleunigt. Besonders deutlich wird dies durch die verbreitete Akzeptanz an Homeoffice und Coworking-Modellen seitens der Arbeitgeber:innen. Distanzen können auf diese Weise klug überwunden und die Arbeitszeit in vielen Aspekten effektiver genutzt werden.
Diese technische Begebenheit bringt uns zum nächsten Trend der non-stationären Kollaboration. Hier gelingt es im besten Fall, Arbeitsabläufe oder Prozesse wie im wahren Leben darzustellen.
Diese Idee ist keineswegs neu, aber durch die technischen Möglichkeiten findet der Austausch von Informationen und Absprachen in einer nie dagewesenen Komplexität statt.
Ein Indiz hierfür ist das große Angebot der SaaS-Produkte und der Server basierten Kollaborationstools wie ZOOM, MIRO Confluence etc.
Natürlich bringt diese neue Art zu arbeiten auch seine Probleme mit sich. Ein individueller und persönlicher Austausch oder das Miteinander werden in diesem Zusammenhang in Mitleidenschaft gezogen. (Quelle: springerprofessional.de)
Neue Generation von Arbeitnehmer:innen
Eine Generation reformiert sich und somit auch die Branchen. Produktionsabläufe und Vorgehensweise werden zunehmend digitaler oder entwickeln sich durch die fortschreitende Digitalisierung rasant.
Um diese Entwicklung zu begleiten, sind eine genaue Beobachtung und Visionen nötig. Da niemand die Zukunft genau voraussagen kann, basieren diese Annahmen auf aktuellen und bisherigen Entwicklungen.
Ein Punkt, der heute schon absehbar ist, ist die Tatsache, dass sich die Lernkultur und die Art des Medienkonsums im Zuge des Generationenwandels stark verändern wird.
Dass sich die Arbeitskultur im Wandel befindet, lässt sich an folgenden Trends beobachten:
- Aktuelle Arbeitsmodelle wie Vier-Tage Woche: Seit 2015 laufen Studien. Diese sind von Arbeitnehmer:innen und Unternehmen in Island erfolgreich durchgeführt worden. Hier lässt sich ein Trend aufzeigen, dass die Vier-Tage-Woche in manchen Berufen einen wirklichen Mehrwert in Bezug auf Effektivität bringen kann.
- Die Anforderungen an den bzw. die Arbeitgeber:in steigen: Die nachfolgenden Generationen an Arbeitnehmer:innen wirken mündiger im Sinne, dass ihre Work-Life-Balance inzwischen einen höheren Stellenwert hat als in den Generationen zuvor. Der bzw. die Arbeitgeber:in ist bemüht, entsprechende Angebote zu schaffen, um auch weiterhin zufriedene Arbeitnehmer:innen beschäftigen zu können. Besonders deutlich ist das in Wachstumsmärkten zu spüren, in denen der Konkurrenzdruck nach frischen und kompetenten Mitarbeitern:innen hoch ist.
- Die Arbeitnehmer:innen werden anspruchsvoller und möchten aktiv an ihrer Entwicklung mitgestalten: Natürlich kennt ein:e Mitarbeiter:in seinen bzw. ihren Stellenwert im Unternehmen und möchte aktiv Einfluss darauf nehmen, wie die Arbeit inhaltlich und strukturell gestaltet ist. Hier spielen Austausch und Weiterbildungsprogramme eine wichtige Rolle.
(Quelle: ingenieur.de)

Generation Z
neugierig. kritisch. anspruchsvoll.
Der Netzwerkeffekt sammelt immer häufiger Menschen auf bestimmten Plattformen. Jede Plattform hat ihre eigene Medienkultur. Diese Kulturen zu verstehen und in der jeweiligen Sprache kommunizieren zu können, stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar.
Die Generation Z wird 2025 ca. 30 % des Bruttoeinkommens in Deutschland erwirtschaften und wird dann die größte Generation an Käufer:innen stellen. (Quelle: felixbeilharz.de)
Besonderheiten der Generation Z
- Extrem medienaffin: Geringe Aufmerksamkeitsspanne und Geduld
- Digital Natives: Keine eigene Erfahrung mit der Vor-digitalen Zeit
- Besitzt hohe Affinität zu mobilen Endgeräten: Primäres Allzweck-Medium: Smartphone
- Nutzung von Short Message Diensten und informieren sich durch Videoangebote
- Hoher Einfluss von Freunden/Freundinnen, (Online-) Bewertungen und Influencern bzw. Influencerinnen
(Quelle: Studie: 2020 Google Search Survey: How Much Do Users Trust Their Search Results?, Herausgeber: Mozjahr: 2020, Land: Global; Thema/These: Vertrauen in Suchergebnisse im Generationenvergleich)
Das Wertemodell der Gen Z basiert weniger darauf, in Wohlstand oder mit Statussymbolen zu leben, sondern konzentriert sich darauf, viel mehr Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung für sich zu nutzen.
Natürlich kommt diese Generation auch nicht komplett ohne Statussymbole aus. Diese sind eher technischer Natur. Hierbei spielen eher Smartphones und mobile Endgeräte die Hauptrolle.
Als täglicher Begleiter und Multifunktionswerkzeug in der Tasche bieten sie eine persistente Verbindung an das Internet und sorgen für regelmäßige Aktualität an News und Updates.
Dr. Christian Wulff kommentierte die Generation Z so:
„Die Generation Z legt Wert auf eine gesunde Lebensweise und kann sich ein Leben ohne Smartphone nicht vorstellen. “Die jungen Menschen haben hohe Erwartungen: Produkte und Dienstleistungen sollen schnell, intuitiv, unterhaltsam und nachhaltig sein.“
Dr. Christian Wulff, Consumer Markets Leader PwC Deutschland und EMEA (Quelle: pwc.de)
Diese Wertvorstellungen lassen sich auch auf andere Bereiche des Lebens der Generation Z übertragen. Besonders wenn es darum geht, sich Wissen anzueignen, sich fortzubilden oder das eigene Karriereziel zu verfolgen.
Mitsprache bei der Gestaltung von Lerninhalten und das kritische Auseinandersetzen mit dem Gelernten sowie eine selbstbestimmte Verifikation der neuen Erkenntnisse und Kompetenzen spielen hier eine große Rolle.
Wie müssen Lernprogramme aussehen?
Aktuell gibt es schon viele Ansätze, wie zukünftige Lernprogramme aussehen könnten. Dies wird deutlich, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut. Wichtig ist herauszustellen, dass die kommenden Formen von Lernkonzepten anders sein werden.
Die Grundlagen erkennen wir schon heute:
- Edutainment: Die Wissensvermittlung ist kein reiner Selbstzweck, sondern gewinnt durch spielerische Ansätze an Relevanz und Nachhaltigkeit.
- Video oder interaktive Angebote: Leicht verständlich in modernen Formaten in kurzen, thematischen Sequenzen.
- Plattformen mit Lektionen wie udemy: Nutzung von Lernplattformen. Beispiel: Die Universität Köln nutzt die digitale Plattform Ilias. (Quelle: ilias.uni-koeln.de)
- Blended learning / Screen based learning: Hybride Lernmodelle zwischen Präsenz- und online Unterrichtseinheiten.
- Zoom Calls / Raum VR Sessions: Nutzung von Videokonferenzen oder virtueller Realität für Lern- und Schulungsmethoden.
Lern- und Educationprogramme werden vor dieselben Herausforderungen gestellt wie Personalabteilungen großer Konzerne und mittelständischer Unternehmen. Um im Wettbewerb um den bzw. die beste:n Mitarbeiter:in mithalten zu können, sind hier besondere Anforderungen zu erfüllen.
Die Herausforderung wird in den kommenden Jahren darin liegen, Schnittstellen und Anbindungen zu AR-Anwendungen und Mehrwerte durch Lernprogramme zu erzeugen.
Folgende Disziplinen haben großen Einfluss auf die Qualität künftiger Programme:
4C Learning (Deutsch 4 K)
- Kreativität
- Kommunikation
- Kritisches Denken
- Kollaboration
5C = Computational Thinking
Dies könnte gerade im technischen Umfeld eine hohe Relevanz haben, da informationelles Denken künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.
- Mehrwerte schaffen / Inhaltliche Möglichkeiten bereitstellen: Vermittlung des Nutzens und des Mehrwertes mit Vorschau auf neue Potenziale.
- Schnittstellen / Anbindung zu AR-Anwendungen: Lernsysteme übertragen sich wechselseitig in haptische und virtuelle Einheiten.
- Software-Angebote und Cloud-gestützte Dienste: Digitalisierte Lern- und Denkprozesse als Basis von Seminaren und Wissensvermittlung.
(Quelle: tezba.de)
forward to the future – Bausteine und Faktoren der Veränderungen

Metaverse. Immersives Lernen. Ansätze für die Realität.
Der Gedanke des Metaverse ist eigentlich kein neuer: Dieses Konzept existiert bereits seit den frühen 1990ern. Durch Entwicklungen und Hardware-Angeboten ist hieraus inzwischen ein sinnvoll einsetzbares Medium geworden, um Kollaboration, Wissensvermittlung und Teambuilding unabhängig von einer festen Verortung durchzuführen.
VR / AR-Anwendungen sind in der Industrie inzwischen einigermaßen bekannt. Oft jedoch nur als Einzelnutzung oder Videoanwendung und nicht in kollaborativer Form.
Diese Beobachtung spiegelt sich ebenso in der Seminargestaltung oder der Wissensvermittlung wider. Vielmehr finden sich aktuell in VR-Anwendungen kaum Remote-Schooling-Konzepte wieder, sondern werden vornehmlich in der Unterhaltungselektronik eingesetzt. (Quelle: statista.com)
Der Begriff Metaverse wird heutzutage inflationär verwendet, beschreibt aber einen Zustand, der bei der Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen einen sehr wirkungsvollen Vorteil hat.
Je nach Gestaltung des Angebotes gelingt es so eine immersive Erfahrung zu machen. Koppelt man diese Immersion an das Gelernte, so wurde gezeigt, dass sich Inhalte und Daten besser und auch nachhaltiger vermitteln lassen. (Quelle: bitkom.org)
Enter the Metaverse

Der reine Gedanke daran, dass man als Benutzer vollumfänglich in eine neue Form der Realität eintaucht, in der die Simulationen und Möglichkeiten schier grenzenlos sind, bringt enormes Potenzial in sich.
Aufgrund dieser Gegebenheit gibt es bereits viele Anwendungen, in denen virtuelle Trainings und Lernkonzepte losgelöst von räumlichen Gegebenheiten stattfinden können. Unabhängig von künftigen Hardwareanforderungen und Anbietern ist dieser Themenkomplex ein wichtiger Faktor.
Eine vollumfängliche Lernsituation im virtuellen Raum als Chance für einige Lerngebiete
Durch die technischen Möglichkeiten einer VR-Anwendung bieten sich viele Vorteile, in Bezug auf dezentrales Arbeiten und vollumfängliches Lernen. In bestimmten Lernsituationen ist es deutlich einfacher, über eine Geschichte oder über eine Bebilderung Informationen oder komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu verinnerlichen.
Mit diesem Gedanken, der Angebotsvielfalt und der damit einhergehenden Erwartungshaltung müssen wir uns vertraut machen, um künftig eine Rolle zu spielen.
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.”
Immersives Lernen

Virtuelles lernen mit Avataren
Virtuelles Lernen oder kurz gesagt VR Learning bietet eine Vielfalt von Vorteilen, obwohl deren Einsatz nicht ganz unumstritten ist. Welche Möglichkeiten sind für den eigenen Bereich relevant oder welche Ansätze sollten verfolgt und adaptiert werden?
Prinzipiell lässt sich die Mechanik des Metaverse ableiten und als Grundlage für neue Lernkonzepte verstehen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Einsparung von Kilometern / Emissionen durch lokales Arbeiten
- Gewinnung von Zeit / Arbeitszeit kann effizienter genutzt werden
- Künftiger Bedarf wird in der Zielgruppe vorhanden sein
- Ausbildung auch überregional
- Schulungen vor dem Beginn der Tätigkeit
- Duplizieren von Maschinen und Anlagen zu Übungszwecken
- Digitalisierung Möglichkeiten
- Skalierbare Campus Lösungen
- Erwerb neuer Kompetenzen
Viele Möglichkeiten bedeuten ebenso einen Eingriff in Strukturen und in bestehende Konzepte. Hierdurch wird klar, dass ein disruptives Denken in der Branche bereits voll im Gange ist. Durch Automatisierung und Prozessoptimierungen wandeln sich Facharbeiter:innen zunehmend zu IT- orientierten Anwendern bzw. Anwenderinnen.
Dieser Trend lässt sich branchenübergreifend beobachten und ist ein starker Indikator für künftige Entwicklungen. (Quelle: industr.com; ingenieur.de)
Der Grund, weshalb immersives Lernen ein wirkungsvolles Mittel ist, ist dass es sowohl kognitiv intensiver als auch selektiver wahrgenommen werden kann, wodurch man in die Handlung wortwörtlich eintaucht. Das Gelernte wird auf spielerische Weise über verschiedene Sinne aufgenommen. (Quelle: telc.net)
Die Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen werden durch Erfahrung und Erlebnis immanenter. Es findet eine Art Kopplung statt, das bedeutet, dass eine Information an eine Geschichte oder ein Gefühl gekoppelt wird.
So werden in diesem Zusammenhang Ereignisse und Wissen im Gehirn nachhaltiger und dauerhafter gespeichert. Ebenso wurde festgestellt, dass Spaß eine große Rolle spielt, um auf spielerische Weise Inhalte gut zu vermitteln.
Funktionsweisen und sachlicher Bezug
Wir wissen, dass sich das Finden von geeigneten Arbeits- und Fachkräften bzw. Seminarteilnehmer:innen in den kommenden Jahren weiter schwierig gestalten wird und attraktive und nachhaltige Lernangebote vorhanden sein müssen.
Schulungen sind nicht mehr zwingend statisch und müssen keinem festen Verlauf folgen. Hier bieten sich neue Lernkonzepte an wie Gamification oder das Lernen durch eigene Erfahrungen und eigenes Erleben.
Dieser Trend geht einher mit der Demografie der künftigen Generationen, die durch den Umgang mit sozialen Medien gewohnt ist, Informationen auf eine andere Art aufzunehmen.
Diese sollte man sich zunutze machen, zumal es noch einen weiteren großen Vorteil hat. Je flexibler das Angebot und die entsprechenden Inhalte, desto flexibler gestalten sich auch künftige Arbeitsmodelle. In einer sich permanent entwickelnden Gesellschaft ist dies ein wichtiger Faktor, um im Arbeitsleben zu bestehen.
Durch Aufstellungsarbeiten, wie in der Psychotherapie angewendet, lassen sich Erlebnisse, Denk- und Lernprozesse aufgrund der Verortung leichter erfassen. Genau diese Methoden lassen sich in der virtuellen Umgebung praktizieren. Das Anwenden und die Nutzung dieser psychologischen Mittel werden künftig ein Teil weiterer Lernmethoden sein.
Zu EHR: Unser Ziel ist, immersive Technologien mit Psychologie zu vernetzen, um kreative Lösungen für die Vorsorge, Diagnose und Heilung von psychischen Erkrankungen zu unterstützen. EHR fördert die daraus entstandenen Anwendungen unter Open Source Lizenz zur freien und weltweiten Verfügung.
Über den Verein: EHR e.V. ist eine Plattform für kreative Köpfe, Spezialisten und Menschen mit Visionen. Wir bieten ein Umfeld für wegweisende Ideen, eine Pipeline von der Finanzierung über Design, Entwicklung und Forschung bis hin zur Bereitstellung innovativer Werkzeuge, die Menschen und Fachleuten maßgeblich helfen. (Quelle: https://www.ehrxr.org)
Die Rückschlüsse lassen sich schon heute ziehen: Modellierung und Erweiterung des Angebotes und ein Abbau von Hürden. Die Investition in moderne Lernsysteme, in den Ausbau einer nachhaltigen Lernkultur, welche Möglichkeiten für aktive Beteiligungen bietet. Als konkrete Beispiele sind eine Form Erlebnis-Vorträge denkbar, welche interaktiv und miteinander verbunden sind. (Quelle: welt.de)
Immersives Lernen Zusammenfassung
Zusammengefasst deutet vieles darauf hin, dass besonders in den Bereich Lernen und Bildung die Angebote natürlich wachsen werden und erheblich an Relevanz gewinnen. Besonders in Verbindung mit erlebnisorientiertem Lernen und in der Vernetzung in einer virtuellen Umgebung.
4C Learning (Deutsch 4 K)
Virtuelles lernen mit Avataren und VR Learning
- Kreativität
Kommunikation - Kritisches Denken
- Kollaboration
5C = Computational Thinking
Der Begriff Computational Thinking stammt aus den 1980ern und wurde für die Lösung von mathematischen Problemen entwickelt. Diese Fähigkeit bot dabei nicht nur Informatikern bzw. Informatikerinnen eine gute Herangehensweise für methodische Kompetenzen.
Die Kernpunkte, um ein Problem zu verdeutlichen, bestehen aus der Abstraktion zur Reduktion von Komplexität, Muster-Erkennung, um den Kern des Problems zu identifizieren und mit Handlungsvorschlägen Methoden für die Lösung zu finden. (Quelle: medienportal.siemens-stiftung.org)
Letzteres könnte besonders in technischen Branchen eine hohe Relevanz haben, da «Informatisches Denken» ein sehr allgemeines Set von Denkfiguren, bzw. Arten des Denkens beschreibt, welche bei der Problemlösung zum Einsatz kommen.
Komplexe Probleme gehören heute schon zu den alltäglichen Anforderungen. Hierbei können diese Methoden auch künftig helfen. Durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz bieten sich durch Kombination künftig weitere Möglichkeiten diese Methoden zu optimieren.

Einsatz von KI
Künstliche Intelligenz ist ebenso wenig neu wie Computational Thinking, sogar weitaus älter.
Originär stammt der Begriff aus den 1950ern, begründet von dem Programmierer John McCarty. Hierbei ging es darum, mathematische Lehrsätze zu beweisen.
Im Laufe der Jahre hat sich natürlich KI genauso weiterentwickelt, wie andere Programm-Prozesse und findet heute bereits in vielen Medien und Hardwarekomponenten Verwendung.
Eine beachtenswerte Entwicklung ist, dass die KI bereits für den Consumer Markt ausgerollt sind und entsprechend über hohe Kapazitäten verfügt. Die aktuelle Version von ChatGPT wird ein Meilenstein bleiben in der Entwicklung, welche jetzt aber von natürlich weiteren Anbietern übertroffen werden möchte.
Ohne näher auf die Tragweite oder Bedeutung von künstlicher Intelligenz einzugehen, ist es spannender, die Zukunft und Zusammenhänge zu betrachten und inwieweit dieses Hilfsmittel im Erkennen von Strukturen künftig bei der Wissensvermittlung helfen kann.
Im Endeffekt ist eine KI eine enorme Datenbank, welche über Mustererkennung und Strukturverwaltung verfügt, aus denen man Inhalte und Wirkungsweisen herauslesen kann.
Sie ist nicht dafür ausgelegt, durch die erfassten Daten in die Zukunft zu schauen oder neue Ideen abzugeben, da sie immer nur das Gelernte vergleicht und neu interpretiert. (Quelle: bosch.com)
Wie sich KI-Modelle in die Wissensvermittlung einpflegen werden, ist heute noch offen; aber feststeht, dass es einen großen Anteil daran haben wird.
Die Besonderheit liegt darin, Strukturen oder bisherige Lernmethoden logisch miteinander zu verknüpfen und diese entsprechend zu spezialisieren oder zu fokussieren. Das heißt, alle bisherigen Lern- und Seminarmodule werden sicherlich hiervon profitieren.
kurzfristige Maßnahmen
Zusammenfassung
Der Trend oder die Entwicklung, um künftig Seminarangebote und Schulungsangebote effizient anzubieten, lässt sich natürlich nicht konkret voraussagen.
Wenn man aber die aktuellen Gegebenheiten genau betrachtet, lassen sich doch einige Rückschlüsse ziehen. Diese werden für die nächsten Jahre richtungweisend sein.
Für die kurzfristige Entwicklung lassen sich jedoch folgende aktuelle Ansätze ableiten:
AKTUELLE ANSÄTZE FÜR VERÄNDERUNGEN (BEISPIELE)
- Videostream / Live-Angebote: Digitales interaktives Lernprogramm und Ausbau des bestehenden E-Learning Angebotes
- Fortlaufende Recherche und strukturelle Anpassungen: Trendmonitoring und thematische Entwicklung sowie Anpassung für neue Angebote und Seminar-Formate
- Wahrnehmung und Social Media: Aktivierung und Wahrnehmung von künftigen Teilnehmer:innen, durch aktivierende Inhalte.
- Inhaltliche Auseinandersetzung neuer Themen: Wegweisende und inhaltlich relevante Themen um höhere Relevanz rund um die Angebote zu schaffen: VR-Training und -Schulungen
Diese Sammlung ist ein Ausschnitt aus gängigen Methoden, um heute Wissen zu vermitteln. Künftig werden andere Faktoren überhandnehmen. Welche diese genau sein werden, lässt sich heute nur schwer abschätzen.
Im Konsens werden sie aber eine Sache gemeinsam haben: Sie werden definitiv vernetzter, kognitiver und intuitiver sein.
Ein Blick in die Zukunft

Die Zukunft der Wissensvermittlung – Der Schlüssel, um die Generation Z für das Berufsfeld zu aktivieren.
Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse lassen sich im Einzelnen konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Zum einen wären die vorbereiteten, aktuellen Themen zu betrachten und zum anderen in weiterer Zukunft die größeren, globalen Veränderungen vorzubereiten.
Dieser Prozess entwickelt sich asymmetrisch mit dem technischen Fortschritt und Innovation, bietet aber auch durchaus genug Spielraum, um auf neue Trends entsprechend zu reagieren.
Konsens:
Da in einer Entwicklung immer viele Faktoren vorangehen, lässt sich natürlich nicht genau sagen, in welche Richtung sich das optimale Lernen bzw. die Vermittlung von Wissen entwickeln wird. Sicherlich stellen Aspekte wie z.B. Immersion und Dezentralisierung einen großen Faktor dar.
Ebenso die Verwendung von KI oder vernetzten Systemen machen hier sicherlich das Spektrum sehr viel breiter als es vorher möglich war. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus allen Faktoren sein, die sich als nützlich erweisen werden.
Eine weitere große Rolle wird Gamification spielen, in der der oder die Nutzer:in seinen bzw. ihren Lernweg selbst durchlebt und somit auf spielerische Weise Neues entdeckt.
Diese Art der selbständigen Arbeit ist sicherlich eine der Kompetenzen, welche in künftigen Berufen sicherlich gebraucht werden, wird.
Es könnte also sein, dass der Lernende der eigene Protagonist seiner Hero-Story ist und der bzw. die Lehrer:in nur ein Begleiter ist, um neue Wege aufzuzeigen, sofern er nicht weiterweiß.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen